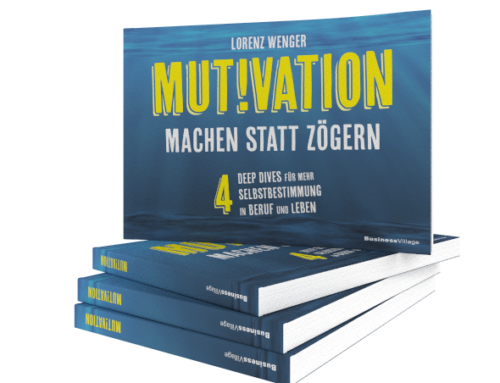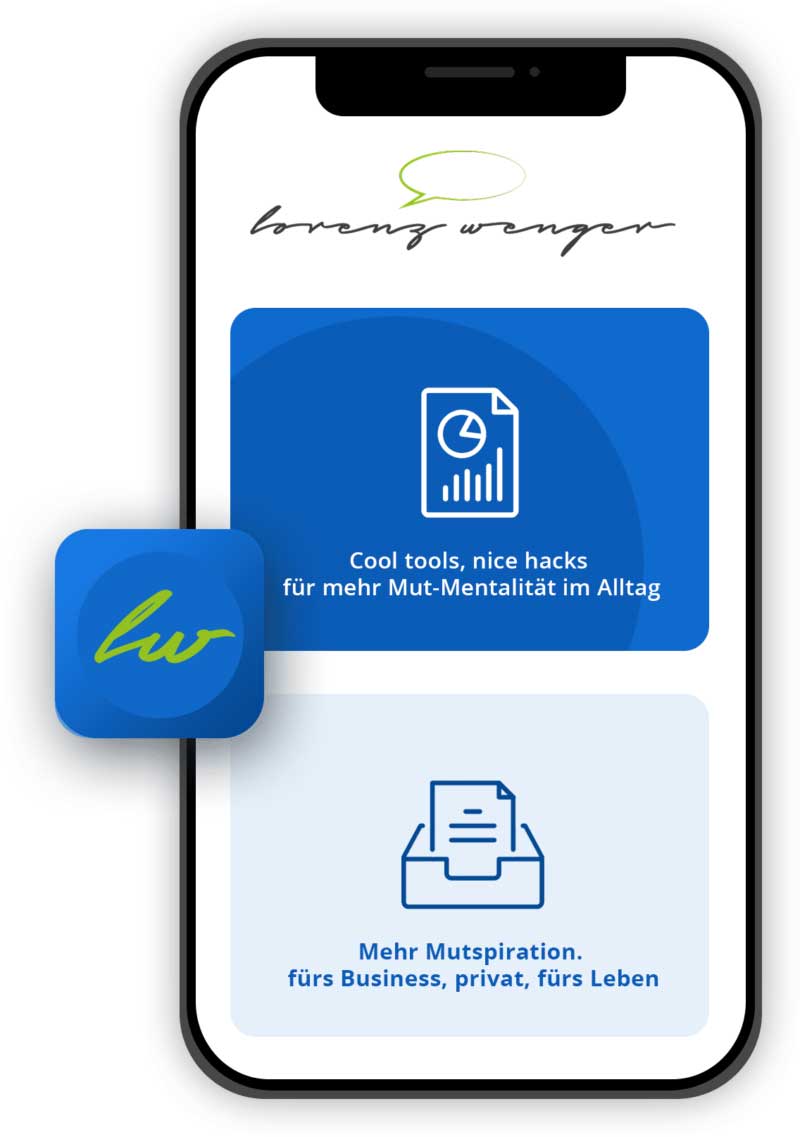Dieser Artikel erschien exklusiv als Gast-Kolumne im Magazin «Direct Point» (www.directpoint.ch), Die Schweizerische Post. Der Autor Lorenz Wenger behält sich das Recht vor, hier die ungekürzte Version zu publizieren.
Fehler zu machen liegt nicht in der DNA der Schweizer Wirtschaft. Fehler zu machen ist für viele von uns unangenehm. Für Fehler gerade zu stehen und Verantwortung zu tragen erfordert Mut. Warum? Weil wir konditioniert sind, alles perfekt zu tun. «Swiss Made» eben. Meine Generation durfte sich in der Schule hinsetzen, wenn man vor der Klasse die Mathe-Gleichung korrekt lösen konnte. Wer noch stand, war entweder noch nicht an der Reihe oder hat einen Fehler begangen – ist gescheitert. Das prägt! Viel zu oft, gehen wir heute zu wenig oder – noch lieber – gar keine Risiken ein. Auf diese Weise müssen wir uns für unsere Entscheidungen und möglichen Fehler weder verantworten noch rechtfertigen. Das ist bequem. Doch ist dieser einfache Weg auch der richtige?
Machen bedeutet Risiko
Unsicherheit bringt nun mal die höchsten Renditen. Das ist bei Weitem nicht nur in der Finanzwirtschaft so. Wenn wir es schaffen, Mut zur Lücke und Unsicherheit zu beweisen, sind die Aussichten auf einen möglichen Gewinn und auf Erfolg grösser, als wenn wir hoffend auf den perfekten Moment warten oder uns perfekt auf die Digitalisierung vorbereiten, während der Mitbewerber bereits am Audit der Beta-Version ist. Der perfekte Moment zur Implementierung wird nie eintreffen. Wer nichts tut, macht vermeintlich keine Fehler. Wer umsetzt und etwas tut, lebt immer mit dem Faktor Risiko, auch wenn dieser noch so klein ist. «Wer wagt, gewinnt!» oder «Den Mutigen gehört die Welt!» sind Plattitüden, die wir alle kennen. Meiner Meinung nach lohnt es sich, hinter diese Binsen zu schauen und unser eigenes Verhalten im Unternehmen kritisch zu durchleuchten. Wann sind Fehler erlaubt, welche Konsequenzen haben sie und wie verwerten wir die Learnings?
Der Perfektionsfalle entfliehen
In meiner täglichen Arbeit mit Menschen der unterschiedlichsten Branchen und Couleur stelle ich immer wieder fest: viele Menschen haben eine ausgeprägte Tendenz zum Perfektionismus. Eine Illusion: Perfektionismus gibt es nicht! Und falls doch: einzig und alleine in unserem Kopf, in unserer Vorstellung. Das stresst ungemein, weil wir diesem Ideal stets hinterherjagen. Wir möchten alles perfekt erledigen und noch viel schlimmer: es allen rechtmachen. Die Angst vor Fehlern, vor Ablehnung, vor dem Versagen, vor dem Scheitern ist bei manchen so gross, dass sie lieber perfekt nichts tun. Diese Einstellung führt unweigerlich in den Mut-Mangel. Perfektionismus lähmt und verhindert Entwicklung, Wachstum und Innovation.
Wer scheitert am besten?
Vielerorts hat sich über die letzten Jahre etwas verändert und die Haltung gegenüber Fehlern wurde in vielen Unternehmen liberalisiert. Möglicherweise eine Kultur, die wir aus der Startup-Szene im Silicon Valley kennen. Von mehreren Quellen wurde mir zugetragen, dass wer dort ein Startup gründen will, ohne mindestens zweimal gescheitert zu sein, findet kaum Investoren. Zu riskant, zu unerfahren für Kapitalgeber. Diese Haltung der Fehlertoleranz rückt manchmal sogar absurd ins andere Extrem: mittlerweile werden auch hierzulande landauf, landab sogenannte «FuckUp Nights» veranstaltet, wo Fehlerkultur, Scheitern und Pleiten gefeiert und gewürdigt werden. Man klopft sich gegenseitig auf die Schultern und verteilt Trophäen des Misserfolgs: Wer hat noch mehr Investorengelder verbrannt, wer noch mehr Startups an die Wand gefahren?
Würden Sie in einem Unternehmen arbeiten wollen, das eine reine Fehlerkultur proklamiert und von seinen Mitarbeitenden Fehler fordert? Warum nicht? Ein Freipass für Fehler ist doch toll: eine grüne Wiese, ein Spielplatz, um sich auszutoben, zu entdecken, zu experimentieren. Eine Einladung, unumsichtig zu arbeiten? Die öffentliche Haltung «In unserem Unternehmen sind Fehler erwünscht» kann ja auch nicht die Lösung des Fehler-Dilemmas sein. «Fehler sind erwünscht» ist die Sprache der Personalgewinner mitten im harten Wettbewerb, auf der (verzweifelten) Suche nach ausgewiesenen Nachwuchs-Fachkräften. Eine solche «Carte Blanche» für Fehler erachte ich aus rein ökonomischer Sicht als bedenklich: würden Sie als Kunde Ihren nächsten Flug über eine Airline buchen, welche Fehlerkultur feiert und offen kommuniziert? Würden Sie das Herz Ihrer Mutter in einer Privatklinik operieren lassen, wo Fehlerkultur mit Stolz gross geschrieben wird? Wohl eher nicht. Stimmts?
Fehlerinkontinenz oder gelebte Fehlerkultur?
Wie geht Ihr Unternehmen mit Fehlern um? Welche Haltung wird von Führungskräften vorgelebt, was wird toleriert, was ist erwünscht? Wir brauchen eine besusste und austarierte Fehlerkultur. Solange wir in einer Welt mit noch lebenden Menschen leben, werden auch Fehler passieren. Wer keine Fehler macht, wirkt unnahbar und unmenschlich. Fehler um jeden Preis zu vermeiden führt in die Perfektionsfalle und in letzter Konsequenz in die Totenstarre. Fehler jedoch in der Öffentlichkeit zu bejubeln ist der falsche Fokus, führt zu Fehlerinkontinenz und einem unsorgfältigen Arbeitsumfeld, das weder im Interesse der Wirtschaft noch im Interesse der Kunden steht. Wie begegnen wir nun diesem Fehler-Dilemma? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch was passiert damit? Die Späne sind die Essenz, aus der Innovation, Fortschritt und letztlich Wachstum entsteht. Es ist Lernmasse. Wo Fehler in einem klar definierten und geschützten Rahmen erlaubt sind und deren Learnings systematisch ausgewertet werden, können neue Ideen, Produkte und Werte geschaffen werden. Für die Perfektions-Haltung bleibt in den heutigen Märkten keine Zeit mehr. Produkte werden heute angepriesen und vermarktet, bevor sie fertig entwickelt sind.
Die Frage bleibt: wann und wo genau lässt Ihr Unternehmen Fehler zu? Es braucht klar definierte und geschützte Rahmen für eine Fehlerkultur, die gelebt werden darf und von Vorgesetzten auch vorgelebt wird. Dieser Rahmen sollte nicht der Markt da draussen sein, sondern vielmehr unsere grüne Spielwiese intern: unser Labor, unsere Werkstatt. Eine differenzierte Fehlerkultur fordert mehr als nur ein Lippenbekenntnis aus dem vordiktierten Leitbild. Unter welchen Umständen dürfen Fehler gemacht werden und wie werden sie dokumentiert? Was sind mögliche Konsequenzen und wer verantwortet diese? Wo Fehler erlaubt sind, ohne sie zu fordern und zu bejubeln, kann Neues entstehen. Also: mehr Mut zu einer austarierten, gesunden und vorgelebten Fehlerkultur!
Dieser Artikel erschien exklusiv als Gast-Kolumne im Magazin «Direct Point» (www.directpoint.ch), Die Schweizerische Post. Der Autor Lorenz Wenger behält sich das Recht vor, hier die ungekürzte Version zu publizieren.