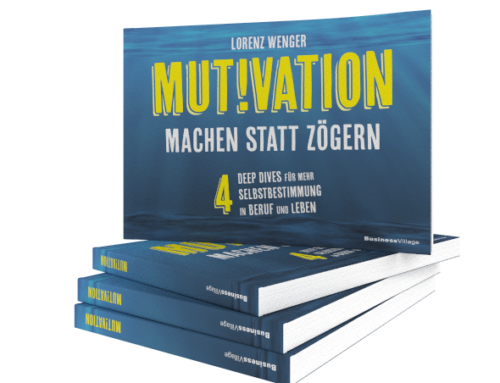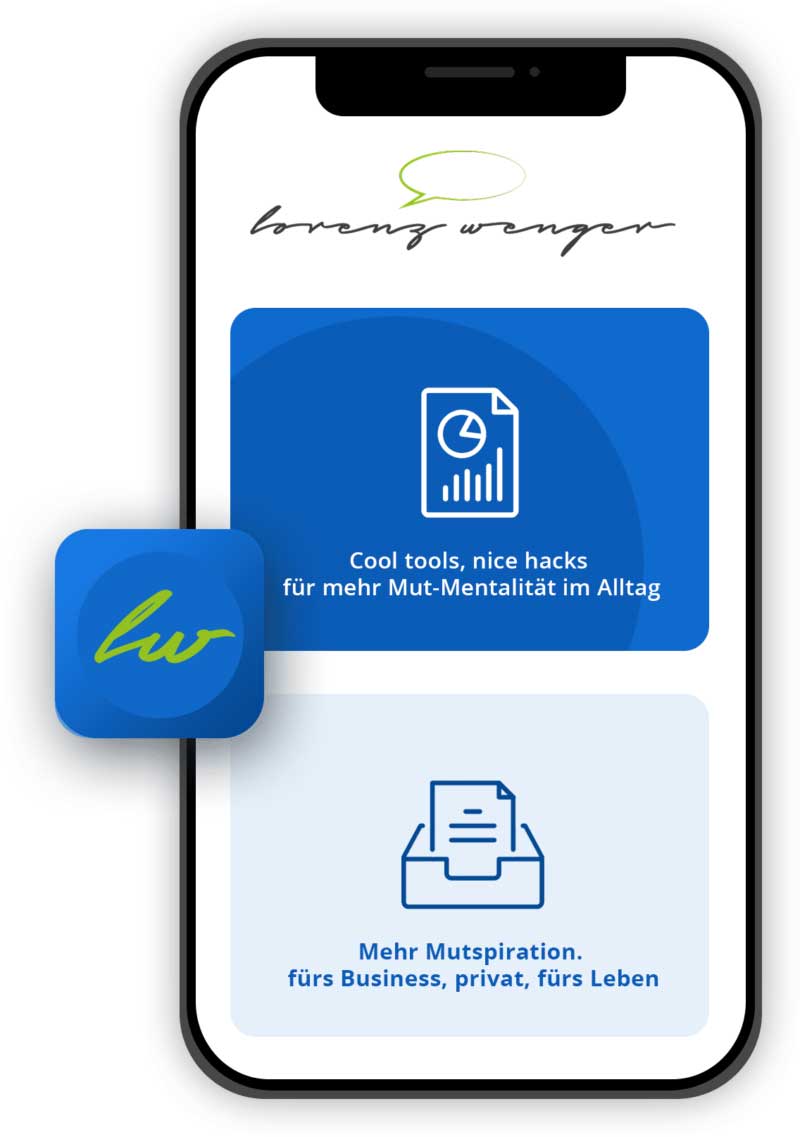Aufgrund der aktuellen Ereignisse werde ich die letzten Wochen und Monaten bei meiner Arbeit oft auf Trumps Rhetorik angesprochen und gefragt, wie seine Kommunikation denn funktioniere. Über politische Rhetorik, insbesondere von Rechtspopulisten, lässt sich bekanntlich Bücher schreiben. Das überlasse ich lieber Politologen und Linguisten. Trotzdem erlaube ich mir, aus Sicht der kommunikativen Wirkung, ein paar „alternative Fakten“ zu Trump zusammenzutragen.
Trump hat für seinen Wahlkampf (und darüber hinaus) bewusst ein reduziertes Vokabular benutzt. Hillary Clinton verpackte während ihres Wahlkampfes durchschnittlich 18 Wörter in ihren Sätzen, Trump nur gerade 11. Das sind rund 40% weniger. Reduktion hilft. Trump hat sich ungehobelt und simpel begreifbar gemacht. Dies war und ist Teil seiner Strategie. Die Rechnung ging bis jetzt auf. Seine Argumente sind einfach, leicht verständlich und zeigen Wirkung durch Emotionen. Durch die Reduktion und Einfachheit der Sprache lässt sich auch auf Twitter Politik machen: 140 Zeichen reichen aus, um solch einfache Botschaften zu platzieren. Die mistverwendeten Wörter von Trump sind „We“ (wir), „They“ (sie), „people“ (Leute), „Country“, „great“ (grossartig). Die allgemeine Meinung beschreibt Trump mit „people say“ („Die Leute sagen…“) oder „many people think…“ („viele Leute denken…“), ohne sich dabei auf Fakten oder Quellen zu beziehen. Er bleibt damit unangreifbar. Die Meinungen seiner Gegner zerschlägt er mit „Wollen wir das?“, „Könnt ihr euch das vorstellen?“. Ohne also die Argumente der Gegner zu nennen oder zu wiederholen, sichert er sich damit die innere Zustimmung seiner Zuhörer. Das schafft Vertrauen und wirkt kompetent, ohne sich dabei auf Details einzulassen. Seine Worte bekräftigt er mit einer klaren Körpersprache und Gestik. Das wirkt, ob wir das wollen oder nicht.
Eine weitere Strategie sind Nebelkerzen wie „alternative Fakten“. Während die Medien laut aufschreien und das Thema überall diskutiert wird, werden im Hintergrund die politischen Fäden gezogen. Die eigentliche Politik geht im Rauschen der „alternativen Fakten“ unter. Ein paar Stichworte: Reduzierung der Mittel für Frauengesundheit, Kappen von Obama-Care, Rücknahme der Obama-Entscheidung gegen die Keystone-Pipeline.
Eingerahmte Bilder im Kopf
Ein aktuelles Buch zum Thema, welches ich empfehle, ist das aktuell erschienene «Politisches Framing» von der Linguistin Elisabeth Wehling. Framing wird auch im NLP (Neruolinguistische Programmierung) verwendet und bedeutet, dass wir Sprache in unserem moralischen, ethischen und eben auch politischen Verständnis einrahmen: wir setzen immer sofort in einen Kontext. Framing ist der Kompass unserer Werte. Dabei entstehen Bilder. Weil wir alle unterschiedlich ticken, haben wir unterschiedliche Frames, also unterschiedliche Bilder im Kopf. Während Politiker von „Einkommen“ sprechen, bedeutet es für die einen Entlohnung im Sinne von „Schmerzensgeld“, für die anderen bedeutet es Eigenleistung. Framing erlaubt uns also einen schnellen und einfachen Zugang innerhalb unserer ideologischen Verständnisses. Und so wird sofort interpretiert. Dies kann man auch politisch nutzen. Und man kann auch manipulieren. Wenn ich „schmutzige Geschäfte“ sage, assoziiert das Gehirn „Schmutz“ und kreiert sofort ein Bild. Ein Gefühl entsteht. Genauso funktioniert das mit „Lügenpresse“ und „Fake News“. Trump nannte Clinton „crooked Hillary“ (gekrümmte Hillary). Auch das ist ein starkes Bild. Ob der Verstand diese Meinung nun teilt oder nicht: unbewusst wurde ein Frame gesetzt und ein neues Bild im Kopf entsteht.
Ähnliche Beiträge
Bereit für deinen nächsten Deep Dive?
Nimm jetzt Kontakt mit uns auf und buche dein kostenloses Erstgespräch.